Louise von Sturmfeder- Die Kinderfrau Kaiser Franz Josephs

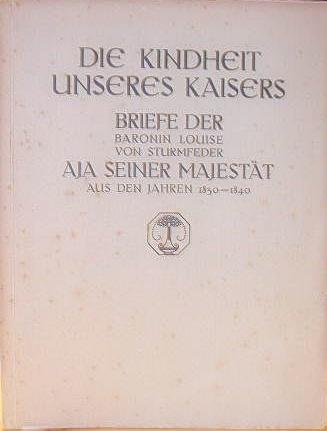
Der Pragmatiker, der Realist, der Erhalter und Verwalter des Erreichten, beseelt von bestenfalls trockenem Humor, der Ehemann einer “wolkenkraxelnden” Kaiserin, deren Gedankenflügen in luftigen Höhen er über weite Strecken wohl nicht zu folgen verstand - so, oder so ähnlich, wird Kaiser Franz Joseph von Österreich noch heute gerne dargestellt. Eugen Ketterl, sein mittlerweile selbst berühmt gewordener Leibkammerdiener, zementierte zudem in seinen eigenen Memoiren das Bild des großväterlichen Monarchen, stets in Uniform auftretend, mit weißem Backenbart und schütterem Haupthaar, in der österreichischen Geschichte ein. Bei Betrachtung der franzisco-josephinischen Ära, die viele Jahrzehnte währte, vergisst man allzu leicht, dass auch ein Kaiser irgendwann die zarten Jahre der Jugend durchlebt haben musste, als Kind mal ungezogen, ungeduldig und frech war, und der strengen Etikette schlicht die lange Nase zeigte. Dass der “kleine Franzi”, wie man ihn in seinen ersten Lebensjahren im Familienkreis gerne nannte, beim Ausflug im Schönbrunner Schlosspark eine Vorliebe für Stein- und Dreckhaufen entwickelte, in denen er zu spielen gedachte, dass er fasziniert war von den Tieren in der Schönbrunner Menagerie, und seinen kaiserlichen “Opapa”, Kaiser Franz II./I. in kindlichem Übermut kräftig an der Nase zog - all das ist mit dem gängigen Bild Kaiser Franz Josephs nur schwer vereinbar.
Hinterlassen hat uns diese Eindrücke Franz Josephs Aja, wie man die Kinderfrauen im Hause Habsburg nannte, Baronin Louise von Sturmfeder, die in regelmäßig verfassten Briefen an ihre Schwestern über das Geschehen am Wiener Hof berichtete, ohne sich in oberflächlichem Tratsch und Klatsch zu verlieren. Baronin Sturmfeder zeigte eine erstaunliche Resistenz gegen die Untiefen des Wiener Hoflebens und konzentrierte sich auf ihre Kernaufgabe, das Wohlergehen und die Erziehung des ersten überlebenden Kindes Erzherzogin Sophies und Erzherzog Franz Carls, des späteren Kaiser Franz Josephs von Österreich.
Louise von Sturmfeder trat ihren Dienst am Wiener Hof durch Vermittlung des bayerischen Königshauses an und begleitete den “kleinen Franzi” vom ersten Tag seines Lebens bis zu dessen sechstem Lebensjahr. Eine ihrer ersten Eintragungen gibt Eindrücke der Geburt des späteren Kaisers von Österreich, die lange und schwierig gewesen sein dürfte. Dass das kaiserliche Kind zunächst nicht schreien wollte, erfahren wir ebenso wie das Auftreten von kleinen Wunden am Kopf des Babys - ein Resultat der Zangengeburt. Es sollte zu ihren Aufgaben gehören, sich um diese Verletzungen zu kümmern - nicht immer im besten Einverständnis mit den zahlreichen Ärzten.
Knapp sechs Monate nach der Geburt wurde der zukünftige Kaiser von Österreich gegen die Blattern geimpft, eine schmerzhafte Prozedur, die nicht ohne Tränen abging, wie Louise Sturmfeder vermerkte:
"Ich ließ den kleinen Erzherzog ausziehen und nahm ihn auf meinen Schoß. Er lachte und war prächtig aufgelegt, seine Mutter war ihm gegenüber, sein Vater flüchtete sich zum Zimmer hinaus. Nach dem ersten Stich begann der Kleine bitterlich zu schreien; man macht ihm drei an jedem Arme. Bald war es geschehen und er wurde wieder heiter.”
Der kleine Franzi zeigte wenige Tage darauf Symptome der Erkrankung, die sich in leichtem Fieber und Hautrötungen manifestierten. Während das Auftreten der Pusteln am Körper des jungen Erzherzogs als kalkulierbares Risiko der Impfung wahrgenommen wurde, galt eine weitere Erkrankung jener Tage, die Cholera, als ungleich gefährlichere Bedrohung, auch in der kaiserlichen Familie. Immer wieder ließ Baronin Sturmfeder die Angst vor einer Infektion ihres
Schützlings mit der grassierenden Seuche anklingen, man trank abgestandenes Wasser mit einer gerösteten, heißen Semmel darin, da dies im Kampf gegen die Cholera “nun alle Welt tue”, wie die Kinderfrau lakonisch bemerkte.
Auch der “Würgeengel der Kinder”, heute allgemein als Diphtherie bekannt, streckte seine Klauen neben anderen Infektionskrankheiten nach den Kindern Wiens aus. Der kleine Franz Joseph allerdings blieb von schweren Erkrankungen verschont und hatte in der kalten Jahreszeit bestenfalls mit Erkältungen zu kämpfen. In dem Eintrag vom 21. November 1831 beispielsweise heißt es: “ Der Kleine hat wieder Schnupfen. Er ist ihm sehr lästig, aber er ist nicht eigentlich krank bis jetzt, Gott sei Dank.”
Auch der Scharlach gab immer wieder Anlass zur Sorge: “Heute war der Kleine schrecklich”, hieß es in einem Brief vom 2. Jänner 1832. “Er fiel jeden Augenblick nieder und jetzt, wo er schläft, hustet er, was mich sehr aufregt, da noch diesen Abend der gute Kaiser (Kaiser Franz II./I., Anm.) zu mir gesagt hatte, dass in Wien die Bräune (Diphtherie, Anm.) und das Scharlachfieber herrschen.”
Ein besonderes Verhältnis unterhielt der kleine Franzi zu seinem Großvater, Kaiser Franz II./I.. Immer wieder hielt Baronin Sturmfeder rührende Szenen in ihren Aufzeichnungen fest, die von ehrlicher Zuneigung und tiefer Verbundenheit zwischen den Generationen sprechen. Der kleine Franz Joseph ging seinen kaiserlichen Großvater regelmäßig besuchen, machte mit ihm gelegentlich sogar Ausflüge in die Menagerie, um dort exotische Tiere zu begutachten. In den letzten Lebensjahren des Kaisers dürfte der langsam heranwachsende Enkelsohn die Lebensfreude des alternden Monarchen zudem gestärkt haben. Es war Baronin Sturmfeder nicht entgangen, dass auch Kaiser Franz II.I. von unterschiedlichsten Leiden geplagt wurde, zu denen neben grippalen Infekten und Wadenkrämpfen auch Zahnschmerzen und Entzündungen der Mundhöhle zählten. Nicht ohne Mitleid ließ Louise Sturmfeder in ihre Berichte einfließen, dass dem guten Kaiser Franz mehr und mehr Zähne gezogen werden mussten, und er häufig das Bett zu hüten hatte.
Eine weitere tragische Figur jener Jahre beschrieb ohne Zweifel Napoleon Franz Joseph Karl Bonaparte, besser bekannt unter seinem Titel Herzog von Reichstadt. Baronin Sturmfeder beschrieb den Sohn Napoleons I. und Enkel Kaiser Franz II./I. als ebenso attraktiv wie eigenwillig, und zweifellos faszinierend. Auch an diesem überaus tragischen Schicksal nahm sie regen Anteil, als sie am 30. Juni 1832 schrieb:
“Der arme Herzog ist immer gleich schlecht. Er leidet grausam; Er soll aussehen wie ein Greis". Tatsächlich fand das Leben des jungen Mannes schon bald in Schloss Schönbrunn ein grausames Ende. Von der Tuberkulose zerfressen, schloss der Herzog am 22. Juli 1832 für immer die Augen. Der kleine Franzi hat ihn sehr gerne gehabt.
Baronin Louise von Sturmfeder war ob ihrer zum Teil unkonventionellen Erziehungsmethoden am Wiener Hof nicht unumstritten, genoss jedoch das Vertrauen der kaiserlichen Familie. Auch Erzherzogin Sophie, deren Image sich uns als gestrenge Schwiegermutter eingeprägt hat, pflegte ein positives und überwiegend einvernehmliches Verhältnis zur Aja ihres ersten Kindes. Den kleinen Franzi nicht zu sehr zu verwöhnen, ihn nicht zu verweichlichen, aber trotzdem sein Wohlergehen stets im Blick zu behalten, war ihr Bestreben. Sie hielt das Kind dazu an, eigene Erfahrungen zu sammeln, weckte seine Neugierde, wies den kleinen Erzherzog nötigenfalls aber auch in seine Schranken.
Das Verhältnis Franz Josephs zu seiner Kinderfrau sollte Zeit ihres Lebens ein positives bleiben, noch viele Jahre später ließ es sich der vielbeschäftigte Kaiser von Österreich nicht nehmen, der
ehemaligen Aja seine Wertschätzung zu erweisen. Als besonderes Zeichen des Vertrauens mag gelten, dass auch die nächste Generation Habsburgs, die kleine Erzherzogin Sophie, Erzherzogin Gisela und Kronprinz Rudolf unter bestimmten Umständen von Louise von Sturmfeder betreut wurden. Als “Interrimsaja”, wie es hieß, sprang Baronin Sturmfeder immer dann ein, wenn die aktuelle Kinderfrau, Baronin Welden, verhindert war. Auch Kaiserin Elisabeth erklärte sich mit dieser Lösung einverstanden, wie folgender Brief von Baronin Kunigunde Dahlberg aus dem Jahr 1856 berichtet:
“Soeben war Tante Ilb (gemeint ist Louise von Sturmfeder, Anm.) einen Augenblick bei mir, um mir zu sagen, dass sie bei der kleinen Erzherzogin ist für die Zeit der Abwesenheit der Majestäten und der Welden. Gestern früh, bevor die Welden mit der größeren Erzherzogin (gemeint ist das erste Kind Kaiser Franz Josephs und Kaiserin Elisabeth, Erzherzogin Sophie, Anm.) abreise, war Tante Ilb bei ihr, um die Kleine noch zu sehen. Um 7 Uhr ward sie zur Kaiserin gerufen, welche sie auf die liebenswürdigste und die gütigste Weise um diesen Beweis ihrer Anhänglichkeit bat, so auch der Kaiser, der dazu kam. Beide dankten ihr, wie Tante Ilb sagte, so herzlich und gnädig. Tante Ilb war noch ganz auseinander. Die Kaiserin sprach noch mit Tante Ilb, wie sie wünsche, dass alles gehalten werde, fragte was Tante Ilbs Ansicht über manches sei. Die Kaiserin war so gut und lieb, dass Tante Ilb noch ganz auseinander war über den Abschied.”
Baronin Louise von Sturmfeder verstarb am 10, September 1866 in ihren Gemächern an einer Herzerkrankung. Kaiser Franz Joseph hatte es sich nicht nehmen lassen, die alte Dame in den letzten Tagen ihres Lebens täglich zu besuchen. Louise wurde siebenundsiebzig Jahre alt. Sechsunddreißig davon hatte sie dem österreichischen Kaiserhaus auf unterschiedliche Weise gedient.
Quelle: Louise von Sturmfeder, Die Kindheit unseres Kaisers; bearbeitet von Anton Weimar. Meistersprung Literatur, 2016